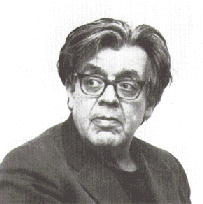
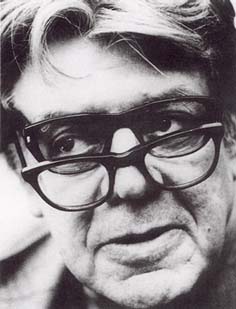

Wohnhaus Fam. Fried
Alserbachstr. 11 1939 |
Erich Fried wurde am 6. Mai
1921 in Wien geboren und wuchs dort auf; sein Vater war Spediteur, seine
Mutter Grafikerin. Er schrieb bereits als Gymnasiast, war Mitglied einer
Kinderschauspieltruppe, bis der deutsche Einmarsch 1938 ihn "aus
einem österreichischen Oberschüler in einen verfolgten Juden
verwandelte." Der Vater wurde von der Gestapo ermordet, Fried
gelang es, nach London zu fliehen und in den folgenden Monaten auch
seine Mutter und mehr als siebzig andere Personen ins englische Exil zu
retten.
In den Kriegsjahren hielt sich Fried mit Gelegenheitsarbeiten über
Wasser, als Bibliothekar, Milchchemiker, Fabrikarbeiter. Er schloß sich
dem "Freien Deutschen Kulturbund" und "Young Austria"
an, später auch dem "Kommunistischen Jugendverband", den er
aber wegen dessen Stalinisierung bereits 1944 [recte: 1943] wieder
verließ. Im gleichen Jahr erschien sein erster Gedichtband,
"Deutschland", im Exilverlag des österreichischen PEN.
Nach dem Krieg wird Fried Mitarbeiter an zahlreichen neugegründeten
Zeitschriften, in den frühen fünfziger Jahren festangestellter
politischer Kommentator der deutschsprachigen Sendungen der BBC; 1968
gab er wegen der unveränderten Kalten-Kriegs-Position der BBC diese Tätigkeit
auf. Schon vorher hatte er sich mit der Übersetzung von Dylan Thomas,
dem ersten größeren Gedichtband ("Gedichte", 1958) und
seinem einzigen Roman ("Ein Soldat und ein Mädchen", 1960)
einen Namen gemacht, ab 1963 gehörte er der "Gruppe 47" an;
in dieser Zeit entstanden auch die ersten Übersetzungen von Stücken
Shakespeares. Eine Übersiedlung von London nach Österreich oder
Deutschland wurde erwogen, wegen der Restauration der fünfziger und frühen
sechziger Jahre aber immer wieder verworfen.
1966 erschien sein Gedichtband "und Vietnam und", der eine
langandauernde öffentliche Diskussion (auch mit Kollegen) über das
politische Gedicht auslöste. In den folgenden Jahren war Fried viel
unterwegs - auf Vortragsreisen, Diskussions- und Solidaritätsveranstaltungen
-, nahm in vielen politischen Fragen Partei (Pressekonzentration,
Unterdrückung des Prager Frühlings, Israel und die Palästinenser,
Polizeiübergriffe, Haftbedingungen politischer Gefangener) und wurde,
als Folge, mit Verleumdungen, Zensur und gerichtlicher Klage überzogen.
Er, der gegenüber dem politischen Gegner stets Liebenswürdige und
Verständnisvolle, hatte schnell mehr Feinde, als er lieben konnte.
Erst 1977 erhielt Fried den ersten ansehnlichen Preis, den "Prix
International des Editeurs"; das prämierte Buch, "100
Gedichte ohne Vaterland", erschien im folgenden Jahr in sieben
Sprachen (in den preisstiftenden Verlagen) und wurde das erste
erfolgreiche Buch, übertroffen lediglich von dem 1979 erschienenen Band
"Liebesgedichte". 1986 veröffentlichte er, in der losen Form
von 29 Prosastücken, seine Erinnerungen ("Mitunter sogar
Lachen"). Der Ruhm und die großen Literaturpreise (Bremer
Literaturpreis, Österreichischer Staatspreis, Georg-Büchner-Preis)
erreichten Fried erst als über Sechzigjährigen und schon lange
Schwerkranken. Erich Fried starb am 22. November 1988 während einer
Lesereise [in Baden-Baden] und wurde auf dem Kensal Green in London
begraben.
(Entnommen aus: Erich
Fried: Gründe. Gesammelte Gedichte. Hg. von Klaus Wagenbach, Berlin:
Wagenbach 1989)
|